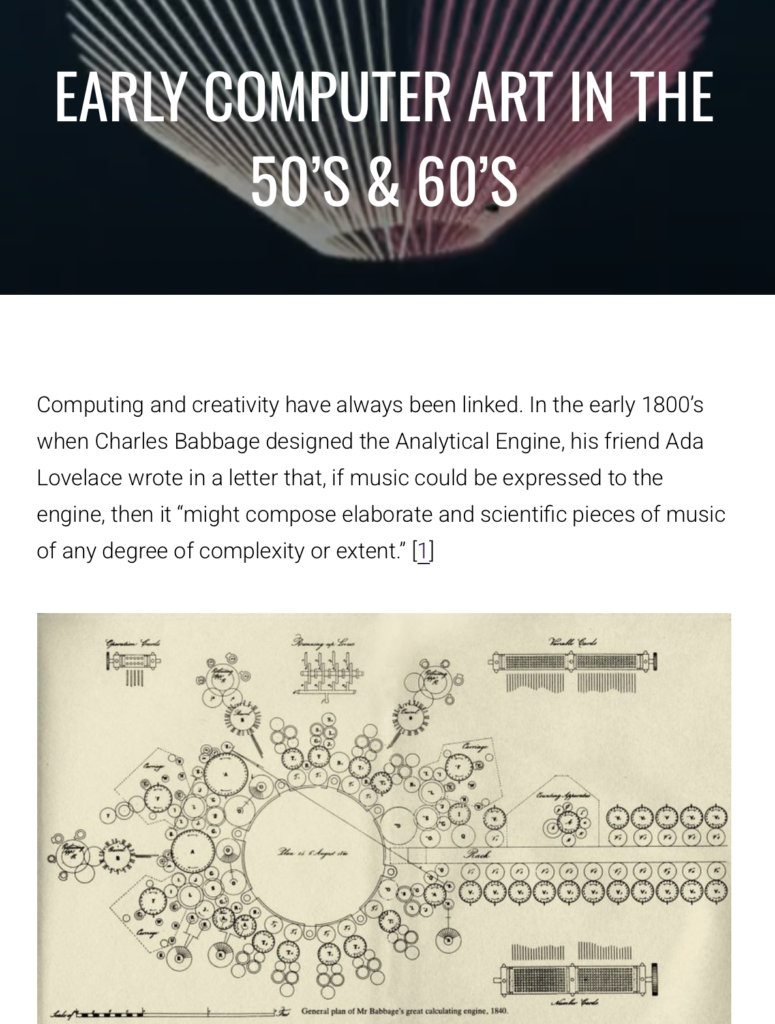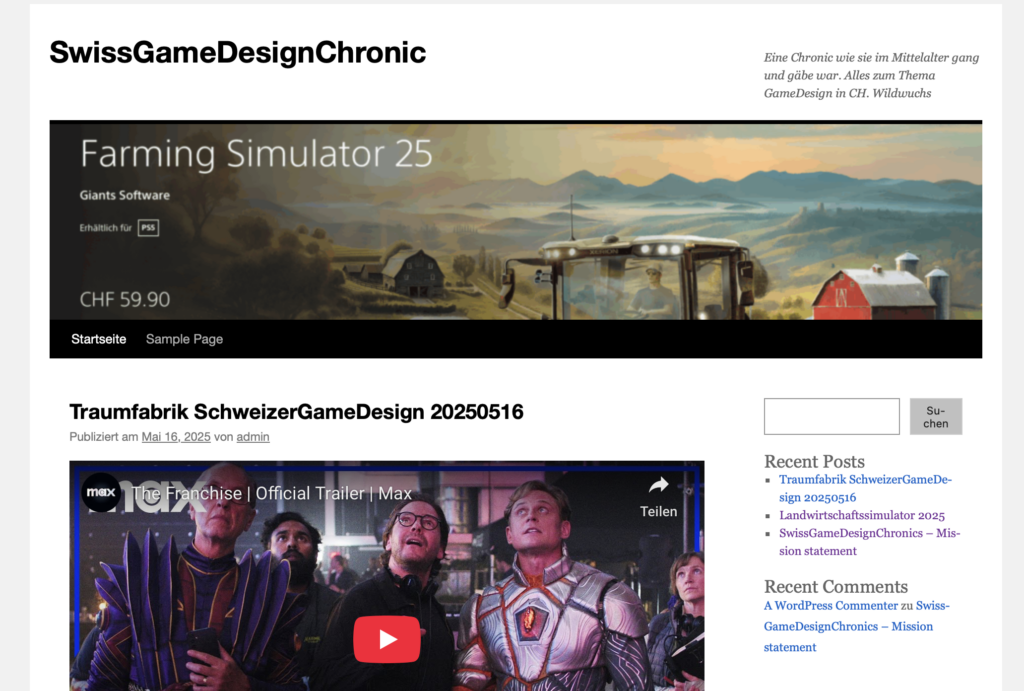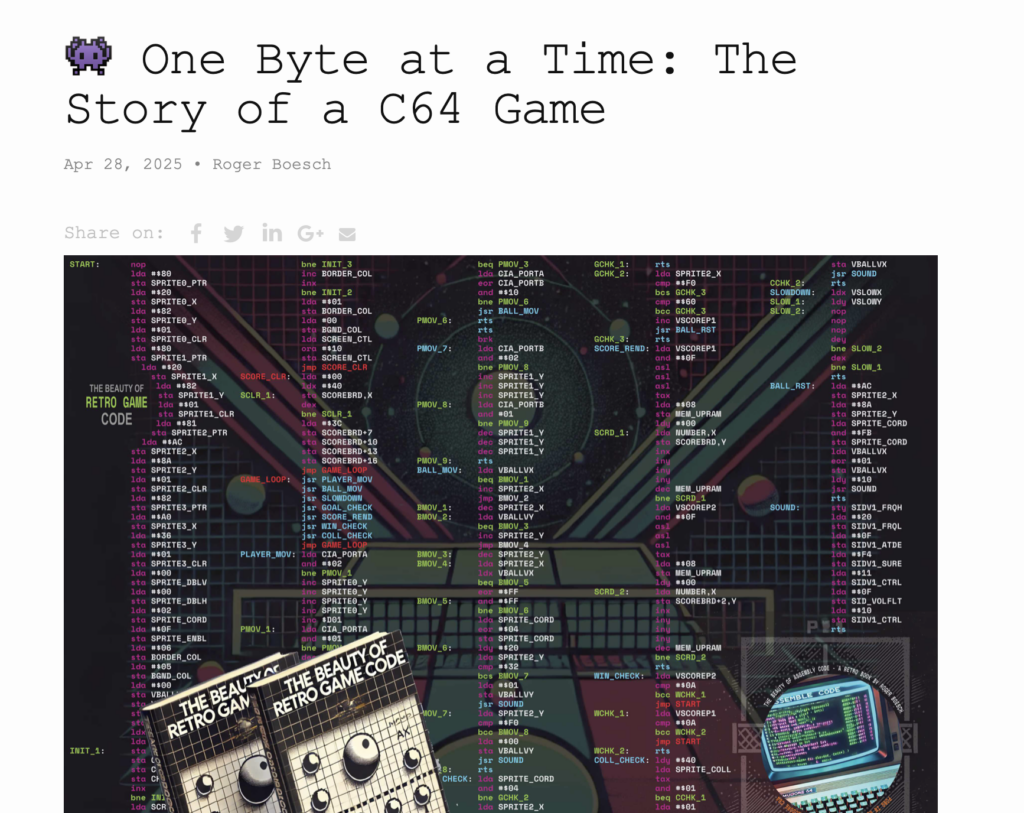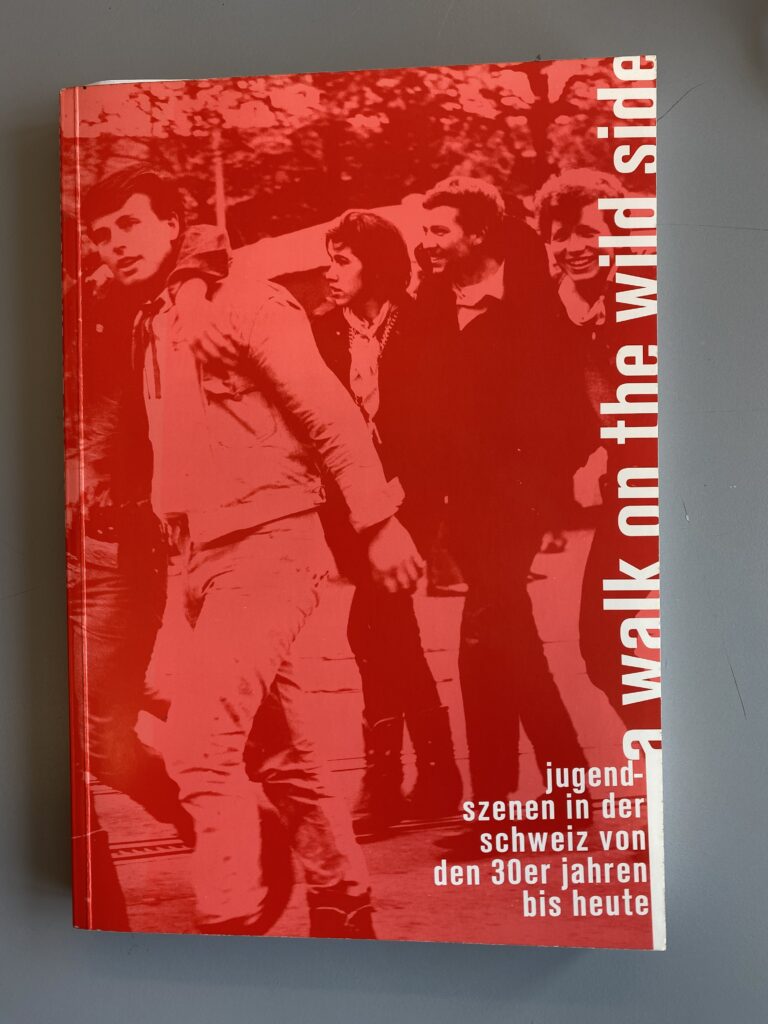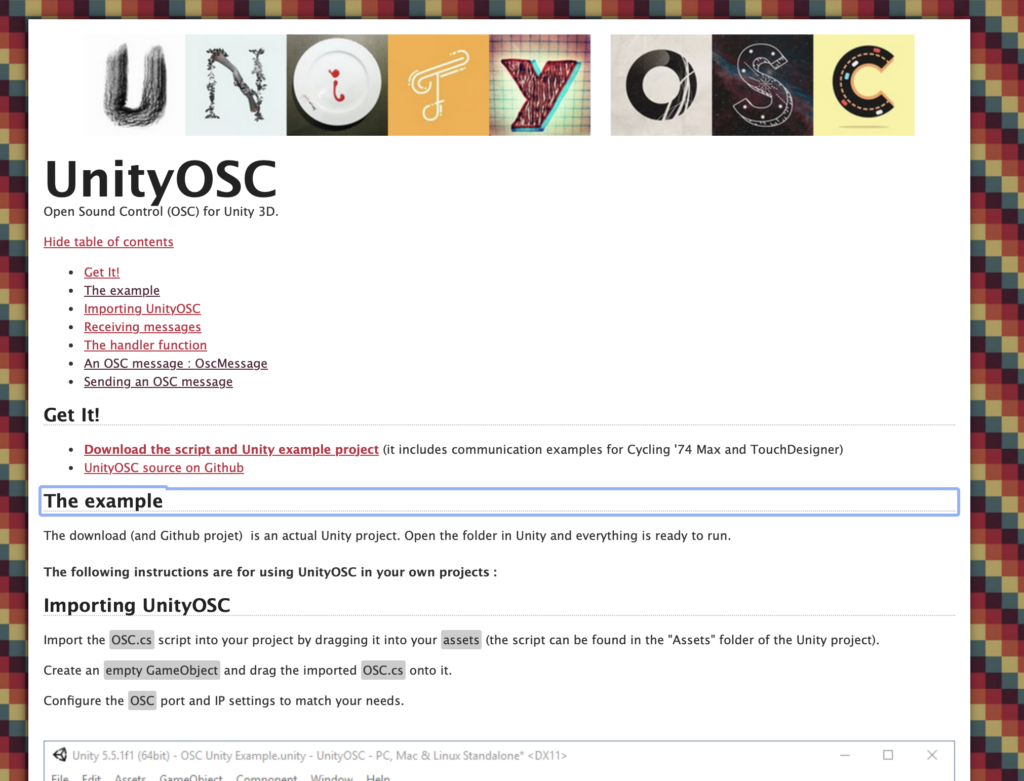Diese zwei Sätze muss man aus Gamedesign-Sicht, heute auch zusammenlesen.
„Wir wollen ja nur Spielen“
Ist ein altbekannter Satz mit mehreren rhetorischen Aussagen und sozialen Strategien.
0. Wir meint eine unendlich grosse und undefinierte Gruppe: Wir sind vermutlich die Spieler*. Also alle die spielen- unabhängig von Status, Intelligenz etc. Wir sind da eine grosse Gemeinschaft, eine Internationale der Spieler*. Diese Bedeutung wirkt sehr Entdifferenzierend, fast so wie das Lachen bei Umberto Eco – es desozialisierst. Es haben ja mal fast alle Menschen (als Kinder) gespielt.
1. Wir wollen spielen und Spass haben. Spielen ist dabei etwas Ungefährliches, etwas das niemandem weh tut – anscheinend. Es gibt einen Magic Circle und dieser schützt die Welt vor den Spielen und die Spiele vor der Welt. Wir Spieler* können also gar nicht böse.
2. Der nächste Schluss: Lasst uns in Ruhe mit Frieden mit Moral und Ethik. Wir wollen nur Spielen! Das ist ja für Kinder und kann nicht gefährlich sein.
3. Bedeutung: „Wir wollen ja nur Spass haben“. Dies ist natürlich ein schmaler Grad. Denn was bedeutet Spass? Gibt es hier ethische Grenzen? Die Gameindustrie kennt oft keine Grenzen. Auch grenzen sich hier Spielende* oft nicht ab. Es geht ja um das grosse Ganze. Hier beansprucht die Spielkultur oft auch die Privilegien der Kunst, eben alles machen zu können. Wobei dies eben auch nicht stimmt, die wenigste Kunst setzt sich gegen den Humanismus und die Aufklärung ein. Und wie ist es mit Spielen wie Manhung und Co? Bei Spielen ist die Grenze oft sehr unklar und die „Freiheit der Games“ ist dann oft einfach ein Freibrief alles machen zu können, sexistisch. Die Begründung: Es ist ja nur ein Spiel.
3. Die Steigerung davon ist die Drohung: Lasst uns in Frieden, wir! wollen ja nur spielen!
4. Die NochWeitereSteigerung war/ist dann in Gamergate zu erkennen: Wir verbieten uns jede Einmischung in Games. Games dürfen machen was sie wollen! Das heisst eigentlich: Wir sind ein moralisch/ethisch freier Spielraum. Jedes Zuwiderhandeln wird massiv sanktoniert.
5. Dies führt dann zu einer implizitem Claim „Nehmt uns nicht unsere Spielzeuge weg!“ und dem nicht gesagten Zusatz: „Oder ihr werdet uns erleben.“. Hier soll und muss auch auf andere toxische Szene geschaut werden – wie teilweise Fussballfans. Die Gamescene ist nur deshalb nicht so militant sichtbar, weil sie nicht im analogen Auftritt sondern in digitalen Medien unterwegs ist, dort aber ihre „Power“ durchaus entfaltet.
6. Oft sind Games heute Eigensozialisierungs-, Ermächtigungsmaschinen (auch Bestätigungsmaschinen) und Safespaces, das heisst sie sind Teil der Persönlichkeit. Sie sind eine Extension des Menschen, wie ein Velo oder ein Auto. Leute identifizieren sich mit Spielen. Interessant hier: Es gibt anders als bei Serien oder Büchern meist keine Entwicklung. Die Leute spielen weiterhin die „Kinderspiele“, auch wenn diese nichts mehr anbieten oder keine doppelten Lesarten haben. Diese Identifikation kann bei einer Konfrontation mit anderen Meinungen zum Spielen, dann tatsächlich als einem Angriff auf die Persönlichkeit gelesen werde. Ähnlich wie wenn jemand etwa bestimmte Bücher ’schlecht‘ macht, die wichtig sind.
Gerade Nummer 4 ist äusserst problematisch. Da die Gameindustrie oft nicht bereit ist irgendwelche Normen einzuhalten oder sich auch nur sozial zu verpflichten. Dies trifft natürlich nicht nur auf die Spieler* zu sondern auch auf die Macher*.
„Wir wollen ja nur Games machen.“ [Kurznotiz]
Die Macher* von Games verstehen sich mehrheitlich auch als Spielende*.
Weiterlesen